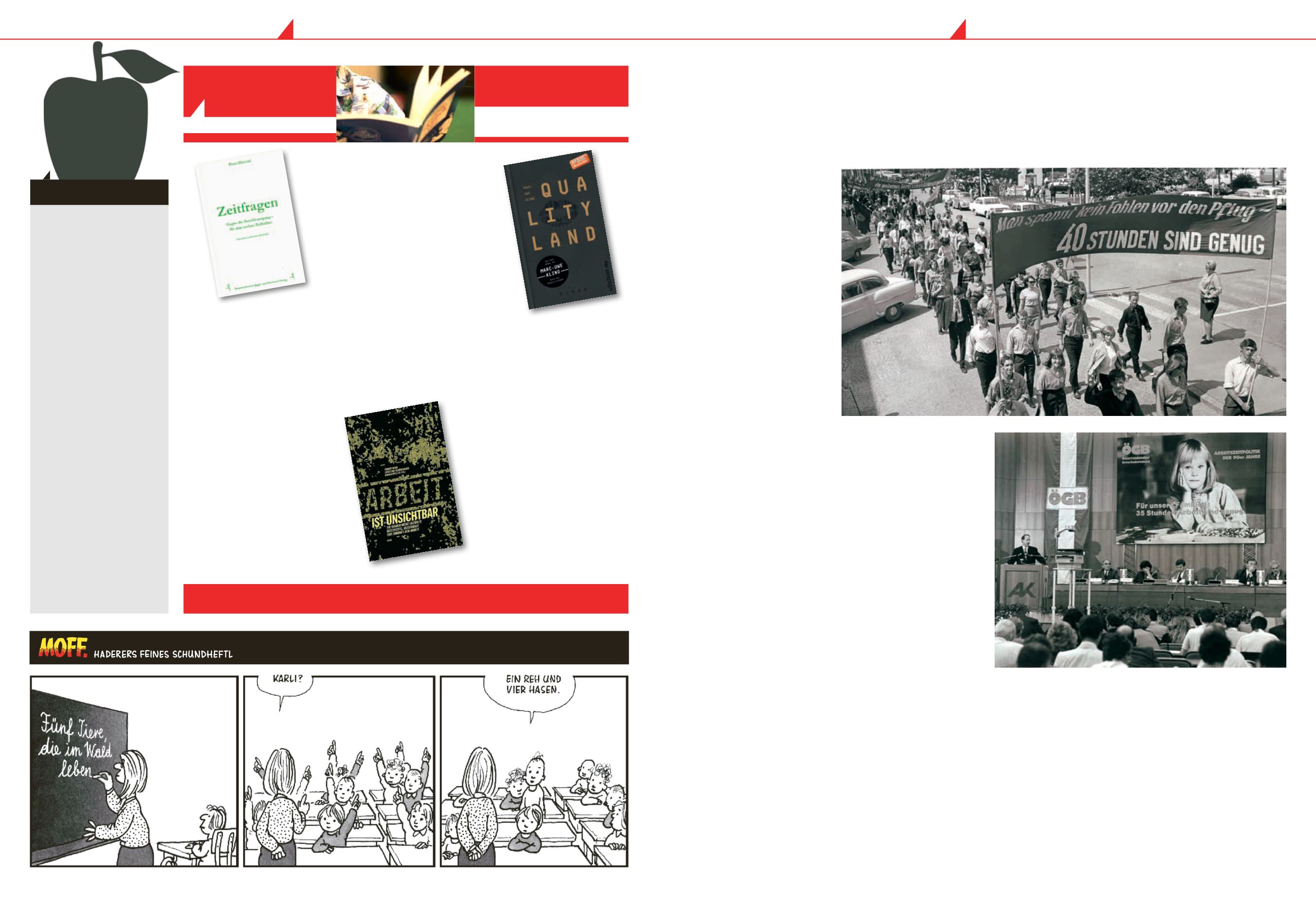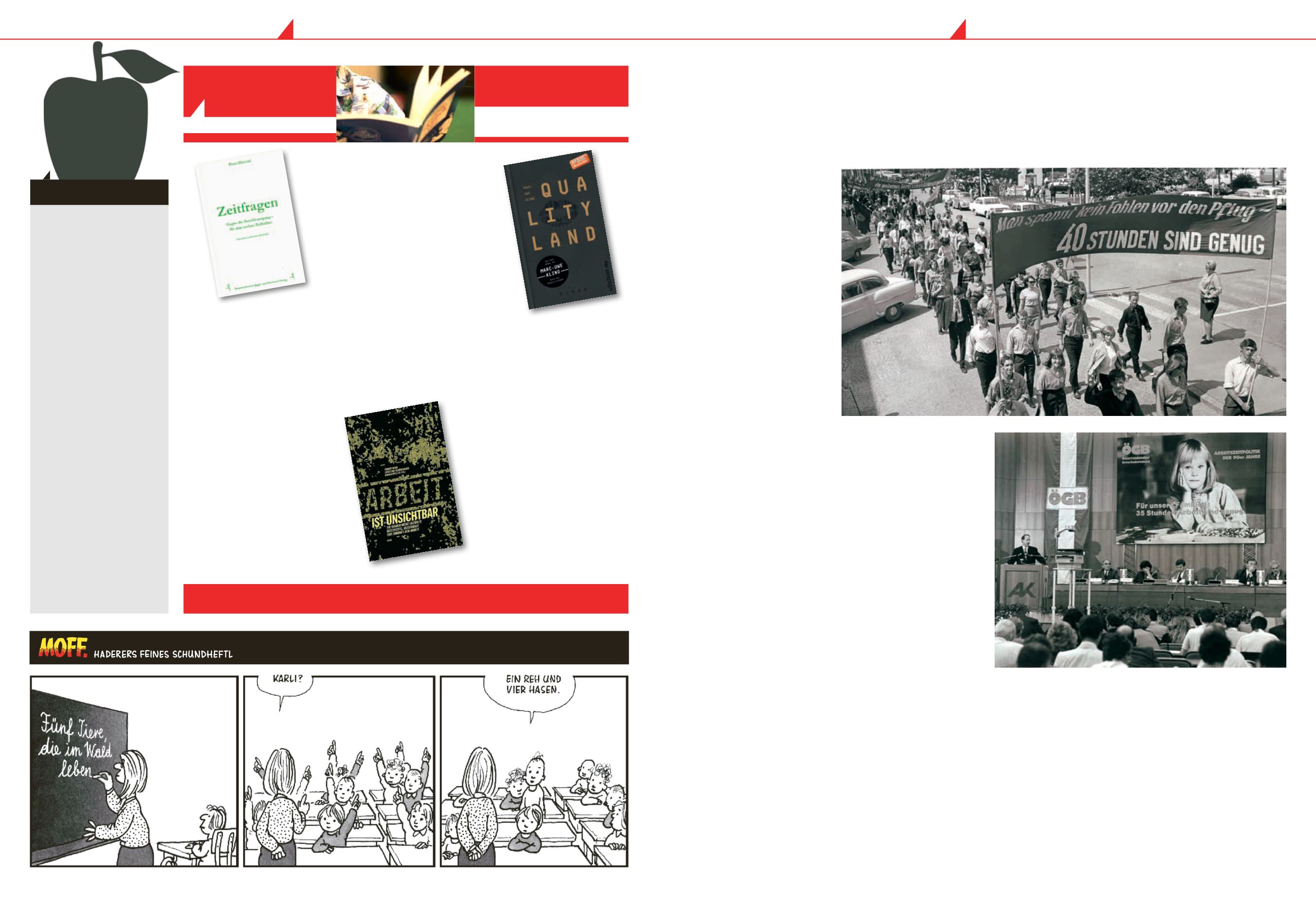
ZAK
25
24
ZAK
SERIE
INS SCHWARZE
Willi Tell
So gute Worte
Früher waren mir manche
Worte so richtig sympathisch.
Sie klangen einfach gut und
tönten nach „Mir nach!“. Mo-
dern – war das Gegenteil von
ewiggestrig. Flexibel – nur
nicht starr und stumpf werden!
Reform – Veränderung und so-
mit Verbesserung. Schlanker
Staat gegen überbordende Bü-
rokratie.
Die Lebenserfahrung lehrt
mich nun, diesen Ausdrücken
zu misstrauen. Bei „Moderni-
sierung des Arbeitsrechts“ stei-
gen mir die Grausbirnen auf.
Bei „Reform“ denke ich auto-
matisch an das Bildungswesen
und dass nach all den gut ge-
meinten Reformen immer we-
niger Schulabgänger lesen und
schreiben können. „Flexible Ar-
beitszeiten“ bedeutet im Klar-
text, dass es immer weniger an
Verlässlichkeit gibt, auf die ich
mich einstellen kann. Und dass
wir unser tagtägliches Leben
immer mehr fremdbestimmen
lassen.
Willi Tell
FRISCH
GEPRESST
AUS DER AK-BIBLIOTHEK
r
Robert Misik / Welzer,
Harald / Schörkhuber,
Christine: Arbeit ist
unsichtbar.
Die bisher nicht erzählte
Geschichte, Gegenwart und
Zukunft der Arbeit.
Diese Sammlung erzählt über
die Welt der Arbeit: über Ar-
beitsstolz und emotionale Kom-
petenz, über Kooperation und
Solidarität. Über Hierarchien und
Effizienz, über Respekt und Iden-
tität und über die politische Ge-
schichte der Arbeiterbewegung.
„Arbeit ist unsichtbar“ ist das
Begleitbuch zur gleichnamigen
Ausstellung im Museum Arbeits-
welt in Steyr.
Marc-Uwe Kling:
Quality Land.
Roman.
Willkommen in Quality Land, in
einer nicht allzu fernen Zukunft:
Alles läuft rund – Arbeit, Freizeit
und Beziehungen sind von Al-
gorithmen optimiert. Trotzdem
beschleicht den Maschinenver-
schrotter Peter Arbeitsloser im-
mermehr dasGefühl, dassmit sei-
nem Leben etwas nicht stimmt.
Wenn das System so perfekt ist,
warum gibt es dann Drohnen,
die an Flugangst leiden, oder
Kampfroboter mit posttrauma-
tischer Belastungsstörung? War-
umwerden dieMaschinen immer
menschlicher, aber die Menschen
immer maschineller?
Peter Heintel:
Zeitfragen.
Gegen die Beschleunigung –
für eine andere Zeitkultur.
Ein philosophischer Begleiter.
Früh wie kein anderer hat der Kla-
genfurter Philosophieprofessor
Peter Heintel darauf hingewie-
sen, wie wichtig gelegentliches
Innehalten für den Menschen
ist. Heintel, Gründer des „Ver-
eins zur Verzögerung der Zeit“,
ist seit Langem überzeugt, dass
Entschleunigung nottut. Er zeigt,
wie wichtig es für den Menschen
und die Gesellschaft ist, von Zeit
zu Zeit innezuhalten, um sich
von fremdbestimmten Vorgaben
zu lösen und auf den eigenen
Rhythmus zu besinnen.
Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag
Picus Verlag
Ullstein Verlag
Der 8-Stunden-Tag.
Für
die meisten von uns Norma-
lität – und dennoch immer in
Diskussion. Während andere
Länder mit einer Verkürzung
experimentieren, geht es bei
uns in Richtung 12-Stunden-
Tag. Zeit für einen Blick in
die Vergangenheit, zu vielen
Kämpfen um eine geregelte
Arbeitszeit.
D
er Rückblick zeigt, dass
eine kürzere Arbeitszeit
nicht immer selbstverständlich
war, sondern über Jahrzehnte
hinweg von der Arbeiterschaft
erkämpft werden musste. Im
Zeitalter der Industrialisierung
war die herrschende wirt-
schaftliche Auffassung, dass
die Arbeitskraft eine Ware sei
und ihr Preis, ebenso wie die
Tagesarbeitszeit, sich nach
Angebot und Nachfrage richten
soll. Die Lohnarbeit entstand.
In den Fabriken wurden auf-
wändige Arbeitsschritte in vie-
le, kleine und leicht erlernbare
Teilschritte zerlegt.
Arbeiten bis zum Umfallen
Für die neue gesellschaftliche
Klasse – die Arbeiterschaft –
waren Arbeitszeiten von zwölf
bis 16 Stunden die Regel.
Man arbeitete praktisch bis
zum Umfallen. Zum Schutz
der Arbeiterschaft forderte
die Arbeiterbewegung eine
Regelung und Verkürzung der
Arbeitszeit.
1884 erstreikten Bergarbeiter
eine erste gesetzliche Arbeits-
zeitbeschränkung. Die täglich
zulässige Arbeitszeit in den
Bergwerken betrug nun zehn
Stunden. 1885 folgten die
Arbeiterinnen und Arbeiter in
den Fabriken mit einer Höchst-
grenze von 11 Stunden, einer
vorgeschriebenen Einhaltung
von Arbeitspausen sowie der
Festlegung der Sonn- und
Der lange Kampf
um geregelte Arbeitszeiten
Zwei Jahre vor der gesetzlichen Verankerung der 40-Stunden-Woche im
Jahr 1969 ging die Gewerkschaftsjugend in Krems für dieses Anliegen
auf die Straße. 1991 wurde bei einer ÖGB-Versammlung eine weitere
Arbeitszeitverkürzung diskutiert.
Vom 1. bis 31. August ist die Bibliothek geschlossen!
Gerne beraten wir Sie in dieser Zeit telefonisch: 05 77 99/23 78
Feiertagsruhe. Bereits 1890
demonstrierten weltweit bei
den 1.-Mai-Feiern die Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerin-
nen für einen 8-Stunden-Tag.
Die Parole lautete 8 Stunden
Arbeit, 8 Stunden Schlaf, 8
Stunden Erholung.
8-Stunden-Tag ab 1918
Nach dem Ersten Weltkrieg re-
alisierte die Sozialdemokratie
einen großen Teil ihrer Reform-
vorstellungen. Neben Ferdi-
nand Hanusch, Gewerkschafter
und Leiter des Staatsamtes für
soziale Fürsorge, kamen An-
regungen für eine umfassende
Arbeitszeitreduzierung von der
internationalen Arbeitsorgani-
sation, die durch die Friedens-
verträge geschaffen wurde. Der
8-Stunden-Tag wurde erreicht
und dessen Einhaltung durch
Strafsanktionen und Anspruch
auf Überstundenzuschlag ab-
gesichert.
Rückschlag im Faschismus
Im Austrofaschismus und
unter den Nationalsozialisten
kam es zu einer Verschlechte-
rung der Arbeitszeitregelun-
gen. Die tägliche Arbeitszeit
wurde verlängert und – wie
schon im 19. Jahrhundert –
vom Unternehmer bestimmt.
Die Interessen der Arbeiter-
schaft blieben weitgehend
unberücksichtigt.
40-Stunden-Woche
Erst 1959 wurde mit Hilfe der
Gewerkschaft die 45-Stun-
den-Woche vereinbart. Die
Arbeiterbewegung setzte in
der Folge die Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit bei
vollem Lohnausgleich durch.
1969 wurde die 40-Stunden-
Woche im Arbeitszeitgesetz
verankert und 1975 umgesetzt.
In den darauffolgenden Novel-
lierungen wurden unter ande-
rem die Teilzeitarbeit und die
sogenannte „Flexibilisierung
der Arbeit“ geregelt.
AG
ALLERLEI
ÖGB Bildarchiv (2)